Häufig gibt es Streit über die (korrekte) Nennung des Urhebers bei Verwendung eines seiner Werke. So ist in vielen Lizenzen verschiedener (Stock)Fotoagenturen festgeschrieben, dass neben der Zahlung eines Geldbetrags auch die Nennung des Fotografen zur zulässigen Verwendung des Bildes erforderlich ist. Diese Vereinbarungen ergänzen und konkretisieren das Recht des Urhebers auf Nennung, § 13 S.2 UrhG.
Nennung des Fotografen: ein Urheberpersönlichkeitsrecht
Dieses Recht gehört, wie auch das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 S. 1 UrhG), zum unverzichtbaren Kern des Urheberpersönlichkeitsrechts. Somit bedarf es nicht zwingend einer zusätzlichen Vereinbarung darüber im Lizenzvertrag, da dem Fotografen dieses Recht qua Gesetz zusteht. Um Missverständnissen vorzubeugen ist eine vorhergehende Vereinbarung jedoch zu empfehlen.
Zumindest nach herrschender Ansicht in der Rechtsprechung ist es nicht entscheidend, um welche Art der Nutzung es sich handelt. Das Urhebernennungsrecht gilt für jede Nutzungsart (m.w.N. BGH, Urt. v. 16.06.1994, Az.: I ZR 3/92). Eine Nennung ist damit z.B. sowohl beim Versenden eines Fotos, als auch bei der öffentlichen Darstellung erforderlich, wenn keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
Art und Umfang der Nennung richten sich ebenfalls nach der getroffenen Vereinbarung. Besteht eine solche nicht, muss die Bezeichnung zumindest so erfolgen, dass eine eindeutige Zuordnung des Werks zu seinem Urheber möglich ist. Dies erfolgt in der Regel durch Namens- und Ortsnennung; bei mehreren Fotografien auf einer Seite z.B. auch durch die exakte Angabe welches Bild welchem Fotografen zuzuordnen ist. In den Fällen des § 63 UrhG ist bei der Vervielfältigung eines Werkes ebenfalls die Quelle, z.B. der Verlag oder die Zeitung, anzugeben.
Ausnahmen von dieser Quellennennung ergeben sich ebenfalls aus § 63 UrhG. So entfällt die Pflicht in Fällen, die § 63 I UrhG nicht ausdrücklich erwähnt. Dies wären im Einzelnen etwa:
- vorübergehende Vervielfältigungshandlungen gem. § 44a UrhG,
- Vervielfältigungen von Bildnissen durch Gerichte und Behörden zum Zwecke der Rechtspflege/der öffentlichen Sicherheit gem. § 45 II UrhG,
- Vervielfältigungen vermischter Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuheiten gem. § 49 II UrhG,
- Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch gem. §§ 53, 54 UrhG,
- Vervielfältigungen zum Unterrichtsgebrauch gem. § 53 III Nr. 1 UrhG,
- einmalige Verwendungen für Rundfunkzwecke gem. § 55 UrhG,
- Vervielfältigungen in Geschäftsbetrieben im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Reparatur von Geräten gem. § 56 UrhG,
- Vervielfältigungen unwesentlichen Beiwerks gem. § 57 UrhG und
- Vervielfältigungen von Bildnissen nach den Voraussetzungen des § 60 UrhG.
Abweichende Vereinbarung sind möglich und üblich, so dass ein genauer Blick in die jeweiligen Lizenzvereinbarungen unerlässlich bleibt.
Nicht zu verwechseln ist die Urhebernennung jedoch mit der häufig auftauchenden Copyright-Angabe. Diese bezeichnet lediglich den Rechts-/Lizenzinhaber (z.B. die Bildagentur). Dieser muss aber nicht zwingend auch der Urheber sein. So kann es dazu kommen, dass sowohl die Nennung des Urhebers, als auch die des Rechtsinhabers erforderlich ist (beispielsweise die Angabe am Ende dieses Artikels).
Fehlende Urhebernennung kann zu „doppelter“ Lizenzzahlung führen
Wird der Urheber in seinem Nennungsrecht verletzt, kann dies sowohl durch Nicht- als auch durch Falschnennung geschehen. Daraus ergeben sich Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz. Die Höhe eines solchen Schadensersatzanspruchs richtet sich üblicherweise nach den für Fotografen empfohlenen Honoraren. Richtwerte hierfür können sich aus den Empfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) ergeben.
Anerkannt ist im Regelfall ein Aufschlag in Höhe von 100% auf die übliche Lizenz des Fotografen, wenn der Urheber nicht benannt wurde (vgl. BGH, Urt. v. 15.01.2015. Az.: I ZR 148/13 – Motorradteile).
(Bild: © ggerhards – Fotolia.com)
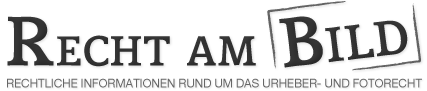

Lieber Herr Rieckhoff,
die Argumentation hinsichtlich der Auffindbarkeit und dem wirtschaftlichen Interesse ist sicherlich ein starkes Argument für eine Nennung. Allerdings muss hierbei unterschieden werden. Bei der Nutzung im Rahmen eines Buches muss regelmäßig der Urheber des Werkes genannt werden. Wird dieses Buch als neues, eigenständiges Werk beworben, so kann grundsätzlich eine Nennung der Urheber der einzelnen in dem Buch verwendeten Werke entfallen. Hiervon kann es Ausnahmen geben, die jedoch stark vom Einzelfall abhängen. Eine allgemeingültige Antwort kann ich Ihnen daher nicht anbieten.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Tölle
Besten Dank für Ihre freundliche Antwort, Herr Tölle!
Guten Tag, Herr Tölle,
muss die Urhebernennung expliziet vereinbart werden, oder anders herum, wenn diese nicht vereinbart wurde, gilt sie dann trotzdem (als vereinbart bzw. als gesetzt) ? Und noch anders herum, wenn sie generell gilt, müsste sie dann im konkreten Falle explizit und schriftlich ausgeschlossen werden, falls der Auftraggeber eines Fotografen auf die Nennung verzichten will ?
liebe Grüße
Thomas
Guten Tag Herr Arendt,
grundsätzlich ist es so, dass die Pflicht zur Nennung sich ohne weitere Vereinbarung aus dem Gesetz ergibt. In seltenen Fällen ist es so, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass eine Nennung angesichts der Üblichkeit bestimmter Branchen/Nutzungen explizit vereinbart werden muss. Dies sind jedoch Sonderfälle, bei denen es ganz auf die Einzelheiten der jeweiligen Situation ankommt. Dies lässt sich nicht Pauschalisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Tölle
ich verlange von meinen Kunden, die bei mir Passbilder machen lassen, dass sie immer einen zettel mit dem Ausweis mitführen und a Flugplatz, bei der Kontrolle auf der Strasse durch die Polizei und so weiter, auf den Urheber des Passbildes hinweisen
Basta
Mit Basta geht’s vielleicht ;-). Das Urheberrechtsgesetz ist da aber deutlich kulanter. Es beschränkt z. B. die Verpflichtung zur Quellenangabe (§ 63) auf die Vervielfältigung und die öffentliche Wiedergabe. Mit Letzterer ist die Wiedergabe in unkörperlicher Form gemeint (z.B. die über das Internet). Als körperliches Werkstück gezeigt werden darf ein urheberrechtlich geschütztes Werk, insbesondere ein Passbild, in der Regel aber auch so. Siehe hierzu die Kommentare unter https://www.rechtambild.de/2014/08/olg-koeln-pixelio-urteil-des-lg-koeln-ist-nicht-haltbar/ vom 19. August und 11. September 2014.
Ich hoffe, dass das so richtig ist.
Hallo Schmunzelkunst,
danke für Deinen Kommentar, ja meiner war auch zum Schmunzeln anregen gedacht.
Nun werden ja auch Bilder für Bewerbungen genannt, wo ist denn da die Grenze, bei einer Bewerbung, oder erst wenn der Kunde viele losschickt?
Meine Kunden müssen das nicht, das ist zumindest meine persönliche Einstellung dazu. Werbetechnisch würde ich denken, es wäre eine Negativwerbung, auch ein aufdringliches Wasserzeichen würde ich als negativ sehen. Nun das ist meine Meinung, wie die rechtliche Situation ist, mag ganz anders sein.
schmunzelnde Grüße
Woifi
Besten Dank, Wolfgang.
Wir haben beide nach Beispielen gesucht, in denen die „Nutzung“ eines Werkes auch ohne Nennung des Urhebers erlaubt sein muss. Das öffentliche Zeigen eines Fotos oder Gemäldes kann ein solches Beispiel sein. Aber vielleicht liegt – zumindest bei mir – hier der Grund für ein Missverständnis vor. Das öffentliche Zeigen, welches das sogenannte Ausstellungsrecht des Urhebers (§ 18 UrhG) tangiert, ist ja vielleicht keine urheberrechtsrelevante Werknutzung im Sinne des obigen Artikels. Mit der Veröffentlichung eines Kunstwerks ist das Ausstellungsrecht des Urhebers erschöpft. Danach dürfen legal hergestellte und erworbene Vervielfältigungsstücke davon auch ohne Erlaubnis des Urhebers z. B. als Wandschmuck in den Fluren öffentlicher Gebäude präsentiert (d.h. ausgestellt) werden. Wenn diese nicht signiert sind, ist m. E. auch die Anbringung eines Schildes mit dem Namen des Urhebers nicht erforderlich.
Bei bedeutenden Kunstausstellungen (z. B. in Museen) mögen manche das anders sehen. Aber da ist ja der Verzicht auf die Nennung der Urheber ohnehin die absolute Ausnahme (wie z. B. bei ausgestellter Graffity-Kunst auf Stücken der Berliner Mauer).
MfG
Johannnes
Guten Abend Herr Tölle,
wir haben vor kurzem durch einen Fotografen Fotos von unserem Betrieb und unseren Mitarbeitern machen lassen, die Fotos sollen nun für unsere Webseite und evtl für Flyer verwendet werden.
Mir stellt sich aktuell die frage, ob ich den Fotografen der Fotos auf der Webseite nennen muss ?
Mit freundlichen Grüßen
Cedric Heß
Sehr geehrter Herr Heß,
die Nennung des Urhebers ist eine regelmäßige Pflicht des Bildnutzers. Lediglich in wenigen seltenen Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden. Mehr dazu u.a. auch hier:
https://www.rechtambild.de/?s=Urheber+nennung
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Tölle
Sehr geehrter Herr Tölle,
zuerst meinen herzlichen Dank, dass Sie diesen Service zur Verfügung stellen. Ich werde mich auf jeden Fall auch bei Ihnen melden, wenn in einem Fall ein Anwalt nötig sein sollte (was ich trotzdem nicht hoffe ;-).
Meine Frage: In einem Vertrag über Illustrationen für ein Buch finde ich folgenden Passus:
„Der Illustrator räumt den Herausgebern an dem Werk räumlich unbeschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts die nachfolgenden ausschließlichen inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte in allen bekannten und unbekannten Nutzungsarten für alle Ausgaben und Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung – insgesamt oder einzeln – für alle Sprachen ein.“
Bedeutet das, dass ich die genannten Rechte zwar einräume, sie aber von Fall zu Fall honoriert werden? Oder bedeutet es, dass ich mit Einräumung der Rechte automatisch auf eine zusätzliche Honorierung verzichte?
Vielen Dank für Ihre kurze Antwort :-)
Beste Grüße
Jan Rieckhoff
Sehr geehrter Herr Tölle,
Wie gehe ich bei Urhebernichtnennung vor?
Kurzform: Der Endkunde weiß von nichts. Urhebernennung bei großer Kampagne ist nicht vorhanden. Die Agentur stellt sich tot. Mit der Agentur war Urhebernennung vereinbart. Der entsprechende Hinweis stand sowohl in der Rechnung, wie im Angebot.
Die Agentur hat die Rechnung beglichen, und zugesagt dass der Endkunde die Urhebernennung vornimmt.
Der Endkunde hat seinerseits eine Abmachung mit der Agentur, dass er keine Urhebernennung vornehmen muss.
Viele Grüße
Sehr geehrte Frau Odenthal,
ich würde Sie bitten, sich zur Beantwortung dieser konkreten Rechtsfrage direkt an unsere Kanzlei zu wenden: 0228 387 560 200 // info@tww.law
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Tölle